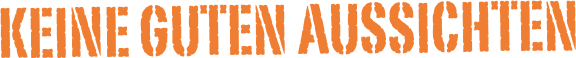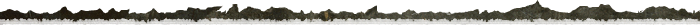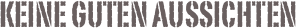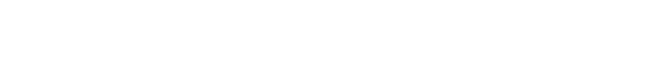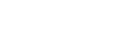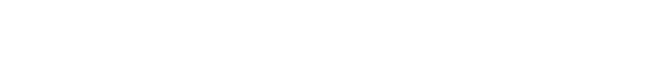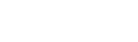Diese Kurzgeschichte wurde im John Sinclair Roman 2275 ,Vampirjagd in Hongkong‘ als Leser-Kurzgeschichte veröffentlicht.
Keine guten Aussichten
2022 © Alexander Weisheit
(weisheit(at)weisheitsperlen.de)
Zuerst möchte ich mich beim Chefarzt Doktor Friebold bedanken. Er hat es mir ermöglicht, dass ich alles aufschreiben und damit die Wahrheit ans Licht bringen kann. In den letzten Tagen habe ich mehrere Gespräche führen müssen, doch es scheint, als würde mir keiner der anderen Mediziner glauben. Immer diese Fragen und Bemerkungen: Sind Sie sicher, dass es so gewesen ist? Denken Sie doch nochmals genauer darüber nach. Kann es sich nicht anders zugetragen haben?
Jetzt habe ich einen Bleistift und Blätter bekommen, um alles auf Papier zu bringen. Ich glaube, ich bin einer der Wenigen, die hier in der Klinik einen Stift bekommen. Und allzu spitz ist er auch nicht, als dass ich mir damit das Leben nehmen oder Anderen Schaden zufügen könnte. Warum sollte ich das auch tun? Ich will, dass man mich versteht und erkennt, dass ich nicht verrückt bin! Deshalb werde ich alles notieren.
Auf jeden Fall sitzt Schwester Eva auf einem Stuhl in der Ecke des Raumes und beobachtet mich ständig. Gut, damit muss ich mich wohl abfinden. Hoffentlich hat das alles bald ein Ende …
Wie Sie sicher wissen, heiße ich nicht Albert Einstein, Tarzan oder Chris Pratt, wie einige andere hier in der Klinik. Ich heiße Michael Gänze. Ich bin 21 Jahre jung und hatte bis vor ein paar Tagen, also bis zu diesem Vorfall, einen Job als Augenoptiker bei Herrn Sehfeld in Neudorf.
Ich bin als Einzelkind bei meiner Mutter aufgewachsen, weil sich meine Eltern früh scheiden ließen. Meinen Vater sah ich ab und zu, doch er trank sehr viel und kümmerte sich nicht wirklich um mich. Ich brach das Verhältnis zu ihm so früh wie möglich ab, und er wollte mich dann auch irgendwann nicht mehr sehen, was mir sehr Recht war.
Mit anderen Kindern verstand ich mich sehr gut, hatte viele Freunde und ich erinnere mich nicht, dass sonst irgendetwas besonderes in meiner Kindheit vorgefallen wäre. Auf jeden Fall hatte ich keine Phantasien, die ich mit der Realität verwechselte, um es mit den Worten der Ärzte auszudrücken.
Nichts verlief unnormal in meinem Leben, bis auf das Ereignis, weswegen ich nun hier in Ihrer Psychiatrie einsitze.
Dabei möchte ich noch einmal betonen, dass ich nichts, was ich getan haben, aus eigener Entscheidung getan habe. Ich war nicht ich selbst!
Okay, das hatten wir ja in den Gesprächen bereits. Ich soll einfach nur alles aufschreiben …
Ich hatte schon früh den Berufswunsch zum Augenoptiker und die Ausbildung absolvierte ich in der Nähe meines Heimatortes Scheibenberg. Durch die Unterstützung meines Ausbilders bekam ich eine Stelle in Neudorf, was auch nicht sehr weit von zu Hause weg war. So kam ich zu Herrn Sehfeld und fand dort eine Anstellung. Das Geschäft war klein, Herr Sehfeld und die Angestellten nett, und ich konnte in meinem Traumjob arbeiten. Alles lief gut, bis zu dem Vorfall in der letzten Woche …
Herr Sehfeld war ein großer Sammler von Brillen. Er hatte in seinem Keller eine Vielzahl verschiedener Brillen von bekannten und unbekannten Menschen untergebracht. Sei es nur ein sehr außergewöhnlich anzusehendes Modell oder eines von einem Star, jedes hatte wohl seine eigene Geschichte zu erzählen. Immer wieder stellte er eine dieser Brillen im Schaufenster aus und drapierte sie mit Informationen und Bildern zu dem jeweiligen Träger. Im Sommer erst hatte er zum 65. Todestag von Bertolt Brecht eine seiner Brillen ausgestellt.
Ich hatte mich schon immer gefragt, wie er an diese, meist seltenen Stücke, herangekommen war. Aber Herr Sehfeld machte meistens ein großes Geheimnis daraus.
„Diese Brillensammlung ist unheimlich wertvoll, musst du wissen,“ antwortete er ausweichend auf Fragen. „Und nicht alle Objekte stelle ich hier oben ins Schaufenster.“ Aber von wem diese Objekte waren, darüber schwieg er sich aus. Den Gedanken, dort unten ein privates Brillenmuseum zu errichten, das niemand zu Gesicht bekommt, fand ich schon seltsam. Finden Sie nicht auch?
Die Neugierde war bei mir auf jeden Fall geweckt, und ich wollte dem Geheimnis der Brillen gerne auf die Spur kommen. Natürlich wusste ich, dass es Unrecht war, in der Privatsphäre meines Chefs herumzustöbern. Doch dieses Gefühl hatte ich an dem Tag nicht.
Es war der 25. Oktober, ein Montag, und Herr Sehfeld war über das Wochenende auf einer Brillenmesse gewesen. Er würde an diesem Tag erst am späten Nachmittag wieder zurück sein. Ich arbeitete jetzt knapp ein Jahr hier und war heute mit der 16-jährigen Praktikantin Monika Franken alleine im Geschäft.
Ich stand gerade hinter dem Verkaufstresen, als Monika aus dem kleinen Nebenraum zu mir kam und auf die Uhr sah.
„Machen wir Mittag? Ich schließe die Türe ab und dann können wir uns ja etwas zu essen holen“, schlug sie vor.
„Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon ordentlich Hunger.“
Ich verschloss die Kasse, die während der zweistündigen Mittagspause nie offenstehen durfte, und Monika die Ladentüre.
„Gehen wir zur Bäckerei rüber? Die haben frisch belegte Pizzateilchen“, fragte ich Monika.
„Okay gerne. Darauf habe ich auch Hunger.“
Also verließen wir die Geschäftsräume, zogen zur nahegelegenen Bäckerei und genossen dort unser Mittagessen. Es dauerte keine Stunde, bis wir wieder zurück waren. Wie jeden Tag setzte ich einen Kaffee auf und freute mich auf das heiße Getränk. In Gedanken spielte ich immer wieder durch, ob ich nicht in den Keller gehen sollte, um mir die Brillensammlung meines Chefs einmal näher anzusehen. Doch wollte ich Monika da nicht mit reinziehen, und sie der Gefahr aussetzen, erwischt zu werden.
Wenn ich jetzt recht darüber nachdenke, war sie ja vielleicht sogar mit Schuld, dass wir in den Keller gegangen sind.
„Sollen wir uns nicht mal die Brillensammlung von Herrn Sehfeld ansehen?“, fragte sie überraschend.
Ich war im ersten Moment zu erstaunt, um ihr antworten zu können und starrte sie über meine Tasse Kaffee hinweg an.
Bisher war ich mir nicht im Klaren darüber gewesen, ob ich wirklich in den Keller eindringen sollte. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, es nicht zu tun. Aber als Monika mich danach fragte, waren plötzlich alle Zweifel wie weggeblasen.
Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn Monika mich nicht gefragt hätte. Vielleicht wären wir nie hinunter gegangen.
Hätte, wäre, würde …
Hinterher weiß man es immer besser.
„Ja klar!“, sagte ich und trank meinen Kaffee aus.
Wir verschwendeten keinen weiteren Gedanken daran, ob es falsch war, was wir hier taten.
Aber es war falsch gewesen. Das weiß ich jetzt. In den letzten Tagen hatte ich mir oft gewünscht, die Zeit zurück drehen zu können. Aber das ist ja leider nicht möglich.
Aus dem Schlüsselkasten nahmen wir den Schlüsselbund für den Keller. Hier hing auch der elektronische Chip dran, der für den verschlossenen Raum benötigt wurde. Warum dieser so offen zugänglich war, wusste ich nicht. Aber Herr Sehfeld schien uns zu vertrauen.
Hinter der Kellertüre führte eine steinerne Treppe in die Tiefe. Die Beleuchtung war hell genug, um alles sehen zu können. Wir waren schon oft hier unten gewesen. Hier gab es das Lager und die Toiletten, sowie Garderobe und Umkleidekabinen. Und ganz am Ende des Flures befand sich die Stahltüre, hinter der sich die geheimnisvolle Brillensammlung befinden musste. Es gab kein Schloss im herkömmlichen Sinne, hier fanden wir einen elektronischen Zylinder vor. Ich hielt den Chip an den Zylinder und ein kurzes Piepen, sowie eine grüne Leuchtdiode zeigte mir an, dass die Tür entriegelt war. Ich griff nach dem Knauf, drehte daran und konnte die Tür aufziehen.
Ich sah kurz zu Monika hinüber, die mir auffordernd zunickte. Lautlos schwang die Tür auf und uns wehte muffige Luft entgegen. Ich tastete an der Innenwand nach einem Schalter, fand ihn und legte ihn um. Ein sehr dezentes Licht leuchtete einen unheimlich altmodisch eingerichteten Raum aus. An den mit Blümchenmuster tapezierten Wänden standen mehrere hölzerne Vitrinen, hinter deren Glasfenster sich verschiedene Brillen befanden. Auf der anderen Seite stand eine alte, hellbraune Couch und daneben ein ebenso alter, durchgesessener Sessel. Davor befand sich ein wuchtiger Tisch mit einer dicken, grünen Marmorplatte. Ein steinerner Aschenbecher stand darauf. Der Boden war mit durchgewetzten Teppichen ausgelegt.
Ich war von der Sorgfalt, mit der die Brillen aufbewahrt und beschriftet waren, fasziniert. Monika wand sich einer Vitrine zu, die etwas abseits von mir stand. Quietschend öffnete sie eine Türe.
„Wahnsinn!“, entfuhr es ihr.
„Mach nichts kaputt“, warnte ich Monika, „sonst merkt Herr Sehfeld das wir hier unten waren.“
Ich blickte durch das Glas einer anderen Vitrine und las Namen von verschiedenen Musikern oder Schriftstellern, die schon lange tot waren.
„Hier ist eine von Helmut Kohl“, sagte Monika begeistert. „Steht die mir?“
Ich drehte mich zu ihr um und sah erschrocken auf, weil sie eine Brille mit großen Gläsern und silbernem Rand auf die Nase gesetzt hatte.
„Pass bloß auf!“, lachte ich, als sie versuchte Helmut Kohl nachzumachen, in dem sie so tat, als hätte sie einen dicken Bauch und würde überlegen, was sie sagen sollte.
In meiner Vitrine sah ich in einer Reihe mehrere Brillen mit runden Gläsern und schmalen, silbernen Gestellen. Mahatma Gandhi, las ich. Dann Rudolf Pleil. Der Name sagte mir nun gar nichts. Die Brille schien auch schon älter zu sein, denn das Gestell hatte Rost angesetzt und die silberne Schicht war größtenteils abgeblättert. Die Gläser wirkten matt. Wie in Trance öffnete ich die Vitrinentüre, griff zielsicher nach dieser Brille und sah sie mir genauer an.
„Ist das nicht der Wahnsinn?“, fragte Monika hinter mir. „Wo Herr Sehfeld die nur alle her hat.“
„Ich habe keine Ahnung“, hörte ich mich sagen, doch die Brille in meiner Hand zog ungewöhnlicher Weise meine ganze Aufmerksamkeit auf sich.
„Was hast du da für eine Brille?“, fragte Monika mich.
Ich drehte mich zu ihr um und sie sah mich über den Marmortisch an.
„Setz mal auf!“
Der Drang, diese Brille aufzusetzen, war schon groß, also hob ich die Hände, klappte die Bügel auseinander und setze sie mir vorsichtig auf die Nase.
„Die steht dir aber überhaupt nicht“, bemerkte Monika, was nur sehr dumpf an meine Ohren drang. Als ich den Blick durch die angelaufenen Gläser warf, war plötzlich alles ganz anders.
Ich überlege schon die ganze Zeit, was damals wirklich mit mir passiert ist. Es war ein merkwürdiges Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein. Ich konnte nicht mehr meine eigenen Gedanken denken, und ich fühlte nicht mehr so, wie noch vor wenigen Augenblicken.
Der Raum um mich herum hatte sich ebenfalls verändert. Er sah jetzt nicht mehr nur so aus, als stamme er aus der Vergangenheit, er war es auch. Ich hatte das Gefühl mich nicht mehr im Keller des Geschäftes aufzuhalten, sondern in meinem Wohnzimmer. Monika vor mir war auch nicht mehr wirklich Monika. Vor mir stand eine junge Frau mit altmodischer Kleidung. Sie sah so aus, wie ich meine Oma früher auf alten Bildern, als junges Mädchen, gesehen hatte. Und sie hatte eindeutig Angst vor mir. Sie stand in eine Ecke des Zimmers gedrängt und sah mich aus verweinten Augen an.
Ich ging lächelnd auf sie zu und griff nach ihrem Arm.
„Du willst mir doch sicher dankbar sein, dass ich dich hier rüber geholt habe, oder?“
Wut stieg in mir auf, als das kleine Ding mir nicht direkt antwortete. Ansatzlos verpasste ich ihr eine Ohrfeige, deren Treffer gleichzeitig mit ihrem Schrei aufklang.
„Das mag ich ja gar nicht. Dafür, dass ich dich über die Grenze geschmuggelt habe, war ich gut genug!“
Die Wut griff weiter nach mir und ich spürte die Hitze in meinen Kopf steigen. Was erlaubte das Luder sich eigentlich? Ein wenig mehr Dankbarkeit hatte ich schon von ihr erwartet.
Nur kurz flackerte die Frage in mir auf, wofür ich Dankbarkeit erwartete und über welche Grenze ich hier redete. Aber die Wut in mir erlangte schnell wieder die Oberhand. Ich spürte die Macht, die ich über diese Frau hatte. Ich wollte sie erniedrigen und demütigen. Dieses Gefühl erregte mich, und ich wollte mir einfach nehmen, was mir zustand. Egal, ob das kleine Biest das verstand oder nicht.
Ich zog die Kleine aus der Ecke, an dem Wohnzimmertisch vorbei und gab ihr einen heftigen Stoß auf die Couch zu. Rückwärts stolperte sie und fiel auf das weiche Möbel. Mit zwei Schritten war ich hinterher und warf mich im wahrsten Sinne auf sie.
Sie fing an zu schreien, strampelte plötzlich und trat nach mir. Ihre Hände fuhren hoch und versuchten mein Gesicht zu treffen.
„Du kleine Schlampe!“, schrie ich sie an, versuchte ihren Angriffen zu entkommen und zerriss wütend ihre Bluse.
Plötzlich fuhr ein Schmerz durch meinen Unterleib, denn die Furie hatte ihr Knie nach oben gerammt. Mir blieb die Luft weg, und diesen Moment nutzte sie aus und schlug mir ins Gesicht. Der Schmerz, der durch meinen Körper schoss, lenkte mich weiter ab.
Das kleine Flittchen wollte sich unter mir herauswinden, aber mein Körpergewicht drückte sie noch auf das Sofa. Ich wurde etwas zur Seite geschoben und musste mich mit einer Hand am Tisch festhalten, um nicht von ihr und vom Sofa zu fallen. Sie kratzte mir mit ihren Nägeln über das Gesicht und hinterließ weitere, schmerzhafte Schrammen.
„Ah!“, schrie ich auf. „Du verfluchtes Weib!“
Meine Hand glitt über die Tischplatte, um einen festen Halt zu finden. Da spürte ich den steinernen Aschenbecher zwischen den Fingern. Ein unheimlicher Hass auf sie stieg in mir auf. Meine Finger umklammerten den schweren Aschenbecher und hoben ihn an. Mein Bein hatte ich auf den Boden gesetzt, um nicht dort unten zu landen.
Als die Kleine sich an der Seite unter mir hervor zwängte, hatte ich bereits ausgeholt und schlug zu. Ein dumpfer Laut erklang, als der harte Stein auf ihren Kopf traf. Von einem auf den anderen Augenblick ließen die Abwehrbewegungen unter mir nach. Blut spritze auf, verteilte sich auf dem Stein, der Couch und meinem Gesicht. Ich schlug abermals zu. Dann ein drittes und viertes Mal, bis meine Wut etwas verraucht war.
Der Schmerz zwischen meinen Beinen drängte sich wieder hervor. Der Aschenbecher fiel aus meiner Hand und mit einem dumpfen Laut auf den Boden. Schweratmend sank ich zurück. Die Frau lag halb unter mir und ihr Oberkörper hing mit blutendem Kopf vom Sofa herab.
Plötzlich juckte es mich an der Nase. Jetzt kann ich nur sagen: Zum Glück!
Wer weiß, wie es sonst weitergegangen wäre. Ich zog die Brille ab, um mich an der Nasenwurzel zu kratzen. Erschrocken hielt ich inne, denn ich sah auf meine blutbeschmierten Hände. Ich musste mich erstmal orientieren und schrie auf, als ich die schreckliche Szene vor mir sah.
Monika hing halb von der Couch, auf der ich saß. Ihr Kopf hing nach unten und ihre Kleidung war zerrissen. Überall war Blut! Ein weiterer Blick zeigte mir, dass ihr Kopf eingeschlagen war. Es sah schrecklich aus und ich musste mich übergeben. Direkt neben den steinernen Aschenbecher, der blutbesudelt auf dem Boden lag.
Um uns herum war alles still. Und Monika war tot.
Ich sah zu der Brille, die ich noch in Händen hielt. Irgendetwas drängte mich dazu, sie wieder aufzusetzen. Doch ich ließ sie einfach fallen.
Dann nahm ich den Aschenbecher auf und schlug auf die Brille ein, bis das Glas zersplitterte. Wieder und wieder schlug ich zu. Bis sie völlig zerstört war.
Unser Chef, Herr Sehfeld kam an diesem Tag doch etwas früher als erwartet zurück und fand mich unten im Keller, auf dem Boden sitzend und an das Sofa gelehnt. Er hielt mich für völlig verrückt und ich habe versucht ihm zu erklären, was passiert war. Vergebens.
Nun sitze ich hier und schreibe das Geschehen auf, damit wenigstens Sie mir glauben. Denn so, wie ich es aufgeschrieben habe, ist es wirklich passiert. Ich kann es selber nicht anders erklären und niederschreiben, so unglaubwürdig es sich auch anhört.
Ich danke Ihnen nochmals, dass ich hier alles aufschreiben durfte und hoffe auf Ihr Verständnis.
Michael Gänze
Dr. med. Oliver Friebold, Facharzt für Psychiatrie & Psychotherapie und Chefarzt des Erzgebirgsklinikum Annaberg (EKA) zum Fall Michael Gänze:
Die vorläufige Diagnose von Herrn Gänze (in weiterem Verlauf der Patient genannt) ist eine dissoziative Identitätsstörung. Sehr wahrscheinlich ausgelöst durch die Brille. Alle Ergebnisse der Gespräche mit dem Patient zeigen, dass er sich an den Ablauf der Tat erinnern kann. Sehr wahrscheinlich aber konnte er daran nichts ändern. Dies spricht für den krankhaften Zwang einer zweiten Persönlichkeit. Die Gefahr eines erneuten Rückfalls ist hoch, solange die genauen Auslöser nicht identifiziert wurden.
Daher sehe ich von einer frühzeitigen Entlassung ab und ordne weitere Therapien und Untersuchungen an. Eine erneute Überprüfung des Gesundheitszustandes des Patienten halte ich in sechs Monaten für sinnvoll.
gez. Dr. med. Oliver Friebold
ENDE